Die repräsentative Demokratie funktioniert nicht so, wie sie funktionieren sollte. Vielen jungen Österreichern fehlt teilweise die Bereitschaft zum Engagement. Der Ruf nach mehr direkter Demokratie ist ein Ansatz – aber nicht die Lösung für alle Probleme. Ein Videokommentar.

An der Demokratie wird ständig gebaut – auch in Österreich Foto: APA/HANS KLAUS TECHT)
Mehr als sechs Millionen Österreicher haben am 15. Oktober die Möglichkeit, Politik zu machen. Dann wird das Parlament für die nächsten fünf Jahre gewählt. Fest steht jetzt schon – ein Teil der Wahlberechtigten wird sich nicht aufraffen, ein Kreuzerl zu machen. Ein Fünftel der Österreicher geht nicht mehr wählen. Viele Bürger sind unzufrieden und haben das Gefühl, nicht wahrgenommen zu werden. Markus Pausch, Wissenschafter für Soziale Arbeit an der Fachhochschule Salzburg, erklärt die Situation: „Die Eliten werden als etwas Abgehobenes wahrgenommen, weil sie von den Alltagssorgen der Menschen weit entfernt sind. Und umgekehrt ist der Eindruck da, dass sich die Bevölkerung von der Politik abwendet. Das ist durchaus der Fall.“
Wie kann man die Distanz zwischen Entscheidungsträgern und den verdrossenen Bürgern verringern? Mehr Sachentscheidungen den Leuten überlassen – das fordert der Verein „mehr demokratie! Österreich“. Derzeit gibt es in Österreich drei Instrumente der direkten Demokratie: Die Volksabstimmung, die Volksbefragung und das Volksbegehren.
Volksabstimmung.
Wenn die Bevölkerung sich bei einer Entscheidung in der Politik beteiligen kann, nennt man das Volksabstimmung. Normalerweise betrifft das Gesetze. Die Regierung macht eine Umfrage, bei der die Bevölkerung mit „ja" oder „nein" antworten, also für oder gegen einen Gesetzesbeschluss stimmen kann.
Volksbefragung.
Bei einer Volksbefragung wird die wahlberechtigte Bevölkerung nach ihrer Meinung zu einem bestimmten Thema gefragt. Es wird dabei entweder eine Frage gestellt, die mit „ja“ oder „nein“ beantwortet werden kann, oder es werden zwei Lösungsvorschläge zur Auswahl vorgegeben. Im Unterschied zu einer Volksabstimmung sind die Ergebnisse einer Volksbefragung rechtlich nicht bindend.
Volksbegehren.
Hat die Bevölkerung ein bestimmtes Anliegen und glaubt, dass die gewählten Volksvertreter sich um diese Sache zu wenig kümmern, kann sie sich mit Hilfe eines Volksbegehrens an den Nationalrat wenden. Dafür müssen mindestens 100.000 Unterschriften von wahlberechtigten Bürgern gesammelt werden.
Quelle: help.gv.at
Im Frauenvolksbegehren engagiert sich aktuell Teresa Havlicek, 28, Journalistin aus Wien. Unter anderem fordert die Initiative gerechtere Löhne für Frauen oder den Ausbau von Frauenhäusern. Volksabstimmungen gab es in der Zweiten Republik bis dato erst zwei: 1978 stimmten die Österreicher gegen das Kernkraftwerk in Zwentendorf und 1994 für den Beitritt zur Europäischen Union. Eine bundesweite Volksbefragung gab es in Österreich überhaupt erst einmal: 2013, als sich die Österreicher gegen die Einführung eines Berufsheeres entschieden.

Politikwissenschafter Markus Pausch findet direkte Demokratie grundsätzlich gut. (Foto: Michael Bartholomäus Egger)
Soll das Volk öfter befragt werden und würde so das Interesse der Bürger an der demokratischen Teilhabe wieder steigen? "Grundsätzlich ja", sagt Politikwissenschafter Markus Pausch. Dennoch gibt es ein Aber: „Es wird immer dann gefährlich, wenn sich die Mehrheit zu Ungunsten von Minderheitenrechten durchsetzt.“ Der einfachste Lösungsansatz? „Die Parteiarbeit sollte wieder näher an die Menschen herangehen“, sagt Pausch.
Michael Egger, Redakteur von „G – Gesellschaft Gemeinsam Gestalten“, analysiert das Thema in einem Videokommentar:

 Autor:
Autor:













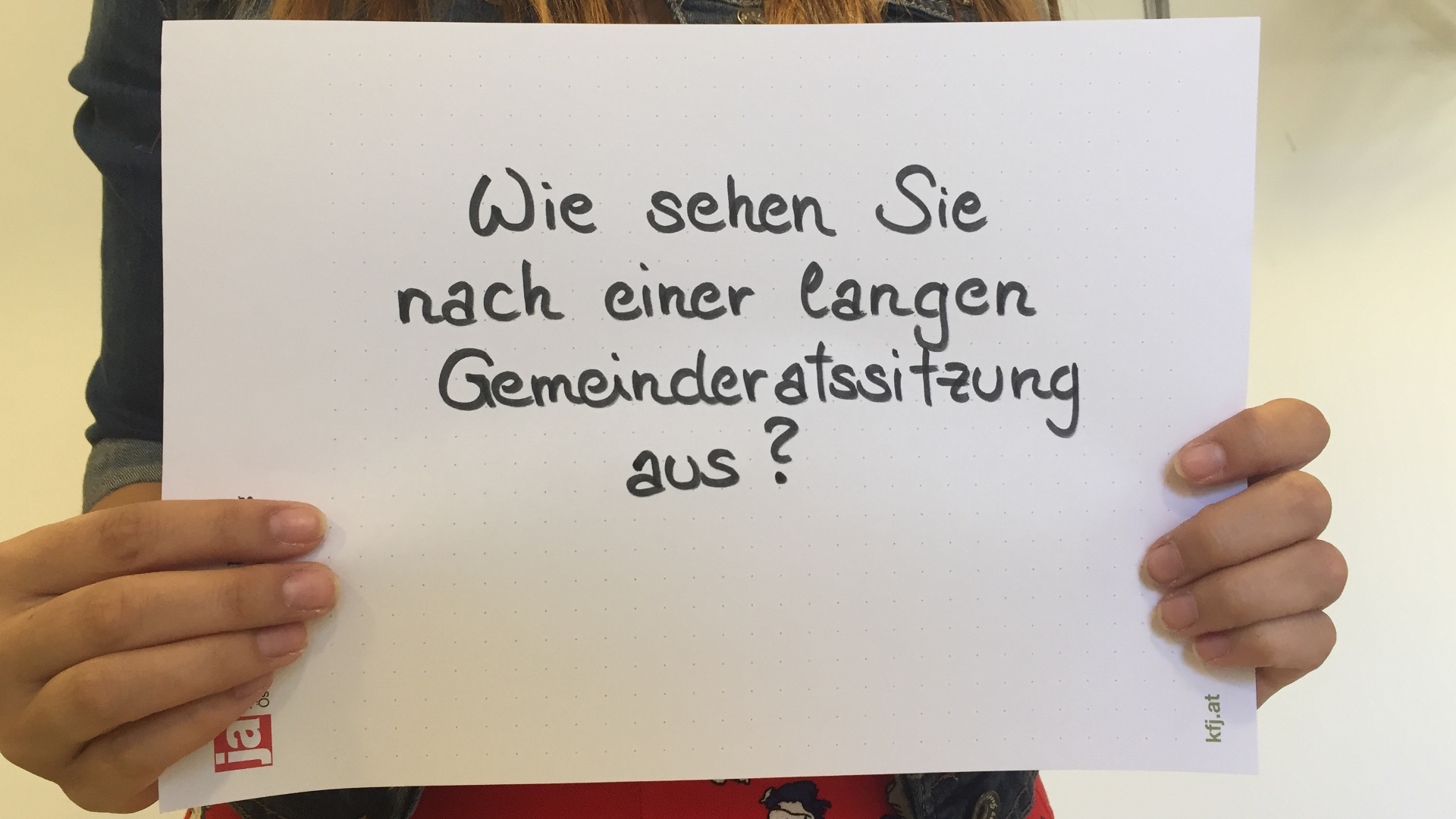





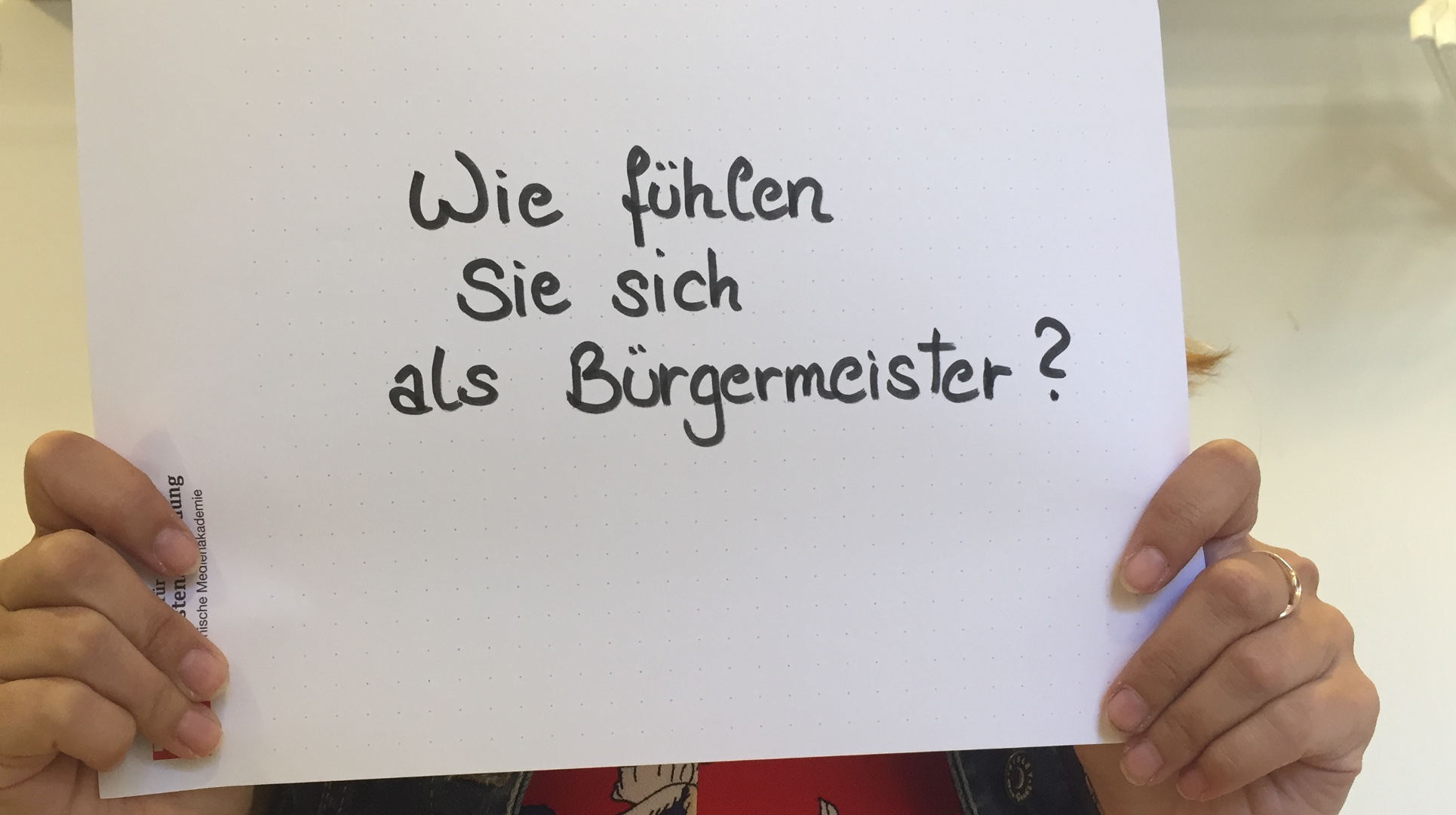



 Autorin:
Autorin:
 Video & Interview:
Video & Interview: