Den jungen Menschen von heute wird nachgesagt, sie wären so unpolitisch wie keine Generation vor ihnen. Wir waren im Unipark Salzburg und haben sie gefragt, was sie beschäftigt und wie sie sich politisch einbringen wollen.
Das Bild hält sich: Von einer Jugend, die keinerlei Interesse an Politik im Allgemeinen und am politischen Geschehen im Besonderen hat. So ganz stimmt das aber nicht. Die Jugend ist politisch. Empfinden Parteien aber oft als zu eng, zu träge, zu alt – einfach zu weit weg von der eigenen Lebensrealität. Politikern gehe es nur um Macht und Geld, nicht um Menschlichkeit. Das macht misstrauisch. Am Wahltag wählen sie oft nur das geringere Übel. Das macht unglücklich.
Hilfsorganisationen und Initiativen passen da schon eher ins Weltbild der jungen Leute. Sie wollen etwas machen, sich aber nicht ewig binden. Also dann aktiv werden, wenn es sich gerade gut anfühlt. Für politisches Engagement fehlt ihnen oft nicht die Zeit, sondern der Antrieb, hinaus zu gehen und die Gesellschaft aktiv mitzugestalten. Vielen aber fehlt das Gefühl, tatsächlich etwas bewirken zu können.

Elisabeth, 21, Studentin:
„Ich finde, dass man über Politik gar nicht genug Bescheid wissen kann. Das Verständnis sollten einem die Eltern schon sehr früh mitgeben. Wenn ich neben dem Studium mehr Zeit hätte, würde ich politisch etwas machen, auf kommunaler Ebene in einer Partei. Das hat mich schon immer interessiert. Themenmäßig interessiert mich die Flüchtlingspolitik. Ich finde, da gehört noch viel mehr gemacht und eingebracht. Und die Politik sollte generell mehr für junge Menschen machen.“

Johannes, 22, Student:
„Um mich selbst zu engagieren, fehlt mir im Moment die Zeit und die Energie. Und für mich passt alles relativ gut, so wie es ist. Ich wüsste jetzt kein Thema, bei dem ich unbedingt etwas verändern wollen würde. Wenn man das große Ganze betrachtet, gibt es auch kaum Unterschiede zwischen den einzelnen Parteien. Jede Partei ist für Kapitalismus. Ob ich jetzt die FPÖ wähle oder die ÖVP, das große System Kapitalismus ändert sich nicht. Wenn, ändern sich nur Kleinigkeiten.“

Theresa, 15, Schülerin:
„Ich habe nicht das Gefühl, dass ich in der Schule ausreichend auf Politik vorbereitet werde. Grundsätzlich interessiert mich schon, was politisch passiert. Aber mich in der Politik zu engagieren, muss dann doch nicht sein. Mir fehlt die Zeit und so stark interessiert es mich dann auch nicht.“

Aliti, 24, Student:
„Ich habe mich noch nie politisch engagiert. Aber ich kann es mir für später vorstellen. Wenn ich einmal mit dem Deutschkurs fertig bin, kann ich mich neu orientieren, was ich genau machen will. Ich interessiere mich sehr für EU-Politik. Mir gefällt die Idee der Union, das Gemeinsame. Und mir gefällt die Politik von Norbert Hofer (FPÖ-Politiker, Anm. d.R.). Ich kann nicht sagen warum genau, und ich weiß, dass er gegen die EU ist. Aber was er über die Arbeit sagt, gefällt mir."

Esther, 28, Studentin:
„Tendenziell interessiere ich mich für Politik eher nicht. Ich habe den Eindruck, dass ich als Individuum wenig Einfluss habe. Ich kann nur wählen gehen. Das tue ich auch, weil es das Einzige ist, was ich politisch machen kann. Aber die Auswahl ist oft moderat. Das heißt, ich wähle oft das geringere Übel. Das ist für mich nicht befriedigend.Was komplett eigenes zu machen, um mich politisch zu engagieren, traue ich mir nicht zu - wegen der Arbeit, die dahinter steckt.“

Lukas, 25, Student:
„Ich gehe zu Wahlen, mehr aber auch nicht. Ich brauche schon für Sport eine große Überwindung. Und ich bin nicht wirklich davon überzeugt, dass ich als Student einen großen Einsatz erbringen kann. Es ist weniger die Zeit, dir mir fehlt, die kann ich mir einteilen. Aber der Wille, in der Politik zu arbeiten, ist nicht groß vorhanden. Ich mache lieber etwas mit Freunden, als Menschen mit Flyern auf die Nerven zu gehen."

Patrick, 21, Student:
„Ich engagiere mich nicht politisch. Meine Partei gibt es nicht. Die sind alle ein bisschen falsch. Etwas Eigenes zu machen, würde mich reizen. Aber ich bin ein kleiner Student. Ich glaube nicht, dass das in nächster Zeit etwas wird. Aber ich habe schon das Gefühl, dass ich als junger Mensch politisch etwas bewegen kann. Mich interessiert alles irgendwie. Die Flüchtlinge, die als die Bösen dargestellt werden, obwohl sie nichts dafür können. Und generell die Ungerechtigkeiten auf der Welt.“

Liliana, 34, Studentin:
„Ich engagiere mich gar nicht politisch. Wobei, vielleicht ist das untertrieben. Ich mache ein paar Veranstaltungen mit Asylbewerbern. Das ist vielleicht schon politisches Engagement, denke ich. Ich bin in keiner Partei, weil ich mich dann entscheiden müsste. Parteien sind mir zu eng. Und ich müsste alles vertreten. Dieses klare Statement zu machen, ist für mich schwierig.“

Daniel, 25, Student:
„Momentan fehlt mir neben Studium und Arbeit für politisches Engagement die Zeit. Nach dem Abschluss kann ich mir vorstellen, in diese Richtung etwas zu machen. Aber etwas, was nicht so zeitintensiv ist. Mich beschäftigen vor allem die Schere zwischen Arm und Reich und Themen wie Umwelt und Flüchtlinge. Ich finde beispielsweise Sebastian Kurz (ÖVP-Obmann, Anm. d.R.) sympathisch. Wie er wirklich ist, wird man aber erst sehen. Ich bin da eher neutral. Wirklich eine Stammpartei habe ich nicht.“

Eva, 24, Studentin:
„Politik ist mir zu wenig greifbar. Es geht nur darum, wer mehr Macht und wer mehr Geld hat. Das hat nichts mit Gesellschaft und Menschlichkeit zu tun. Wenn man die Nachrichten einschaltet, kommt nur noch Negatives. Im Moment glaube ich nicht daran, dass ich mit meinem Engagement etwas bewirken könnte. Ich habe gerade aber auch gar keine Lust, mich damit auseinanderzusetzen. Ich fühle mich im Moment sehr unwohl hier. Ich denke in letzter Zeit oft darüber nach, auszuwandern. Australien soll sehr menschlich sein.“


 Autor:
Autor: Video:
Video:

 Autor:
Autor:













 Autorin:
Autorin: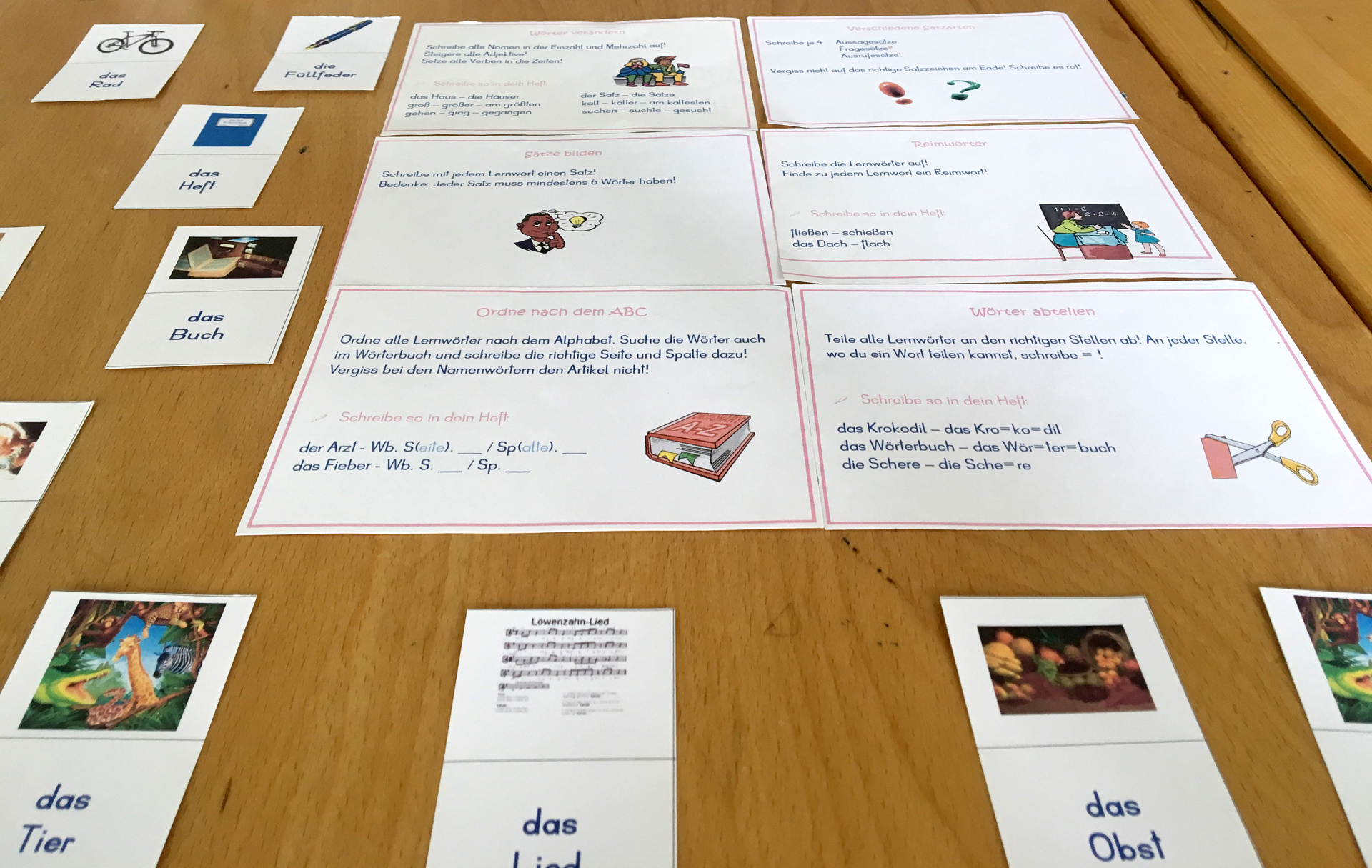

 Autorin:
Autorin:

 Autorin:
Autorin:

 Autor:
Autor:

 Autorin:
Autorin:










 Autor:
Autor:


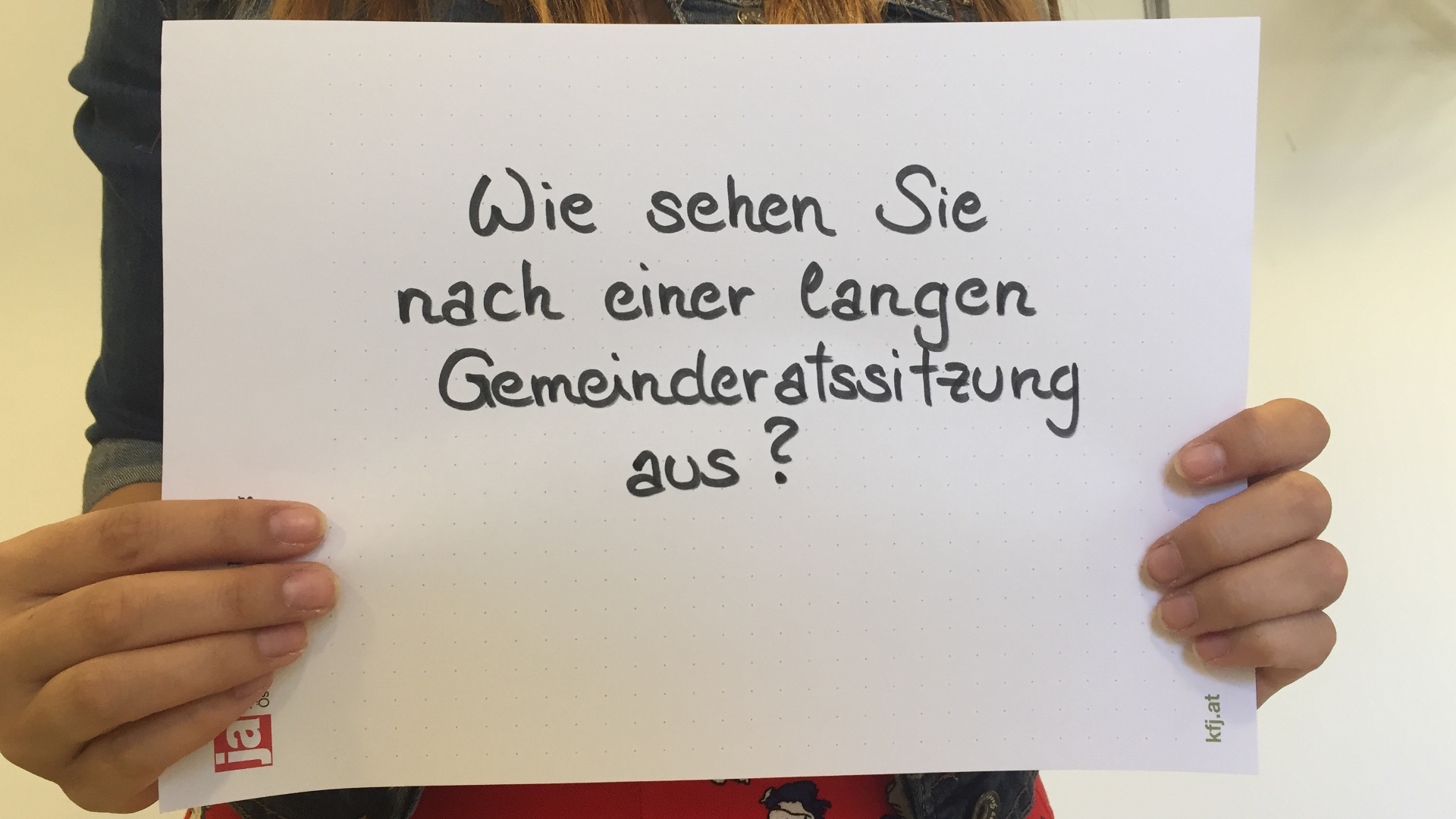





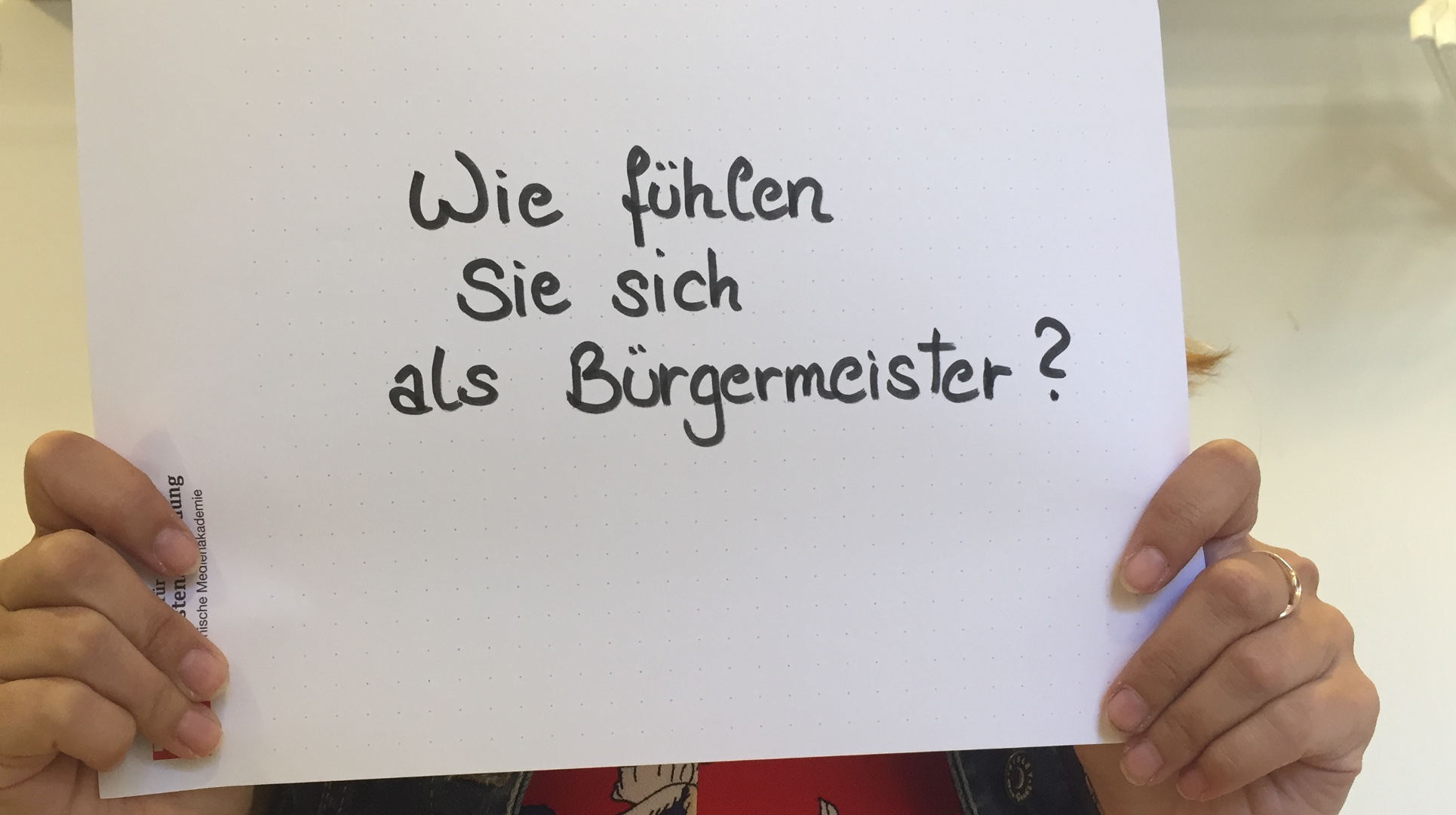



 Autorin:
Autorin: