Das Salzburger Projekt „Gemeinsam wachsen“ vermittelt ehrenamtliche Paten für Kinder psychisch erkrankter Eltern. Nicht nur die Schützlinge profitieren von dieser besonderen Beziehung.
Immer sonntags steht der fünfjährige Elias (Name geändert) auf dem Balkon und hält Ausschau. Sobald seine Mutter den Namen „Jenny“ ausgesprochen hat, sucht der Fünfjährige nach deren Wagen. Bei jedem schwarzen Auto ruft er: „Das ist sie. Da ist die Jenny!“. Manchmal drei Stunden lang. Bis sie dann wirklich pünktlich um 14 Uhr ihren schwarzen VW Polo vor dem Haus parkt, um ihn für vier Stunden abzuholen. Wie jeden Sonntag.
Jenny Cox ist Elias’ Patentante. Die 25-Jährige engagiert sich ehrenamtlich im Verein JoJo, der Kinder psychisch erkrankter Eltern und ihre Familien unterstützt. Der Name des Vereins leitet sich vom bekannten Kinderspielzeug ab. Das Auf und Ab eines Jojos soll die schwierigen Lebensumstände der Kinder von psychisch erkrankten Eltern widerspiegeln. Das Projekt „Gemeinsam wachsen“ des Vereins vermittelt diesen Kindern eine Bezugsperson, die sich einmal pro Woche einen halben Tag um sie kümmert. Ende 2016 hat sich Jenny Cox als Patin für das Projekt beworben – und wurde Anfang des Jahres mit dem kleinen Elias „gematcht“. So nennt die Geschäftsführerin des Vereins, Heidemarie Eher, den Zuteilungsprozess. Der Bedarf, diese Kinder zu unterstützen, ist groß: „Ein Drittel von ihnen wird aufgrund der Ausnahmesituation selbst dauerhaft psychisch erkranken. Ein weiteres Drittel psychisch beeinträchtigt. Und nur ein Drittel bleibt gesund. Unser Ziel ist, diese Zahl zu erhöhen“, sagt die 38-Jährige.
Stabilität und Zeit schenken
Was diesen Kindern hilft, gesund zu bleiben? Zum Beispiel die Betreuung durch einen gesunden Paten, wie Heidemarie Eher sagt. Eine stabile und erwachsene Bezugsperson von außerhalb der Familie sei für die Kinder ein ganz wesentlicher Faktor, um gesund zu bleiben. Seit über einem Jahr gibt es deshalb das Patenschaftsprojekt unter dem Dach des Vereins JoJo. Die Familien, die Betreuung bei JoJo suchen, werden zunächst in einem allgemeinen Programm aufgefangen und von Therapeuten betreut. Aufklärung über die jeweilige Krankheit ist das erste Ziel. Darüber sprechen lernen, vor allem auch mit den eigenen Kindern, gehört dazu. Erst im nächsten Schritt kann bei Interesse ein Pate gesucht werden – entweder als Unterstützung für die ganze Familie oder nur für ein Kind.

Jenny Cox ist als Patentante ehrenamtlich tätig. (Foto: Anna-Maria Schäfer)
Welche Kriterien muss ein gesunder, erwachsener Mensch noch erfüllen, um sich als Pate bewerben zu können? Vorurteilsfreiheit gegenüber Menschen, die psychische Erkrankung haben, ist die Grundvoraussetzung. Man muss sich gern mit Kindern umgeben wollen. Und Zeit haben – ein halber Tag pro Woche ist die Anforderung. Außerdem soll der Wunsch für eine langjährige Beziehung bestehen, wie Eher sagt: „Das ist der Inhalt der Patenschaft. Dadurch, dass unsere Kinder überdurchschnittlich oft Beziehungsabbrüche im Alltag erleben, ist genau diese Stabilität wichtig.“
Das ist auch Patin Cox bewusst: „Ich hole Elias immer gleich ab. Immer mit dem Auto. Seine Mama bringt ihn runter, dann begrüßen wir uns. Das sind feste Abläufe, an die gewöhnt sich ein Kind – und die vermitteln totale Stabilität und Sicherheit.“ Auch der Abschied der beiden ist an ein Ritual geknüpft. Wenn er brav war, darf er sich beim Heimfahren ein Pickerl aussuchen. „Da freut er sich immer. Am liebsten möchte er mir gleich im Auto zeigen, welches Pickerl er sich ausgesucht hat. Da merke ich, dass ihm auch mein Feedback sehr wichtig ist“, sagt die Studentin.
Ein gesundes Umfeld
Patin Jenny Cox hat sich bereits als Jugendliche ehrenamtlich in ihrer Heimat Tirol engagiert. Für ihr Studium der Sozialen Arbeit ist sie nach Salzburg gezogen. Hier hat sie nach einer neuen ehrenamtlichen Tätigkeit gesucht. In einer Zeitung las sie vom Projekt „Gemeinsam wachsen“ – und bewarb sich. Es folgten Gespräche mit Heidemarie Eher sowie einer Psychologin der Vereins. Ein Besuch in ihrer Wohnung gehörte ebenso zum Eignungstest. Da die Paten auch Zeit mit ihren Schützlingen zuhause verbringen, muss dort ebenfalls ein „gesundes Umfeld“ gegeben sein.
Weitere Paten gesucht
Derzeit gibt es im Projekt vier Patenschaften: eine reine Kinderpatenschaft und drei Familienpatenschaften. Bei diesen hat die Patin auch intensiven Kontakt mit den Eltern und entlastet diese – sie ist Ansprechperson für alle und unterstützt beispielsweise bei Behördengängen. Die aktuell betreuten Kinder sind zwischen zehn Monaten und acht Jahren alt. Fünf Kinder haben derzeit noch keinen Paten, es besteht also noch Bedarf, wie Eher erzählt. Doch der Prozess ist aufwendig: Rund sieben Gespräche werden vorab geführt, bis Pate und Kind zusammengebracht werden. Mit dieser langen Auswahlzeit möchte der Verein sicherstellen, dass beide wirklich zueinander passen, wie sie sagt: „Beziehungsabbrüche kennen unsere Kinder genug.“
Der erste gemeinsame Ausflug
Nach mehreren Wochen der Vorbereitung stand fest: Der fünfjährige Elias, dessen Mutter unter psychischen Problemen leidet, sollte Jenny Cox’ Patenkind werden. Es folgte ein Kennenlerntermin gemeinsam mit der Therapeutin, mit Elias, seiner Mutter, Heidemarie Eher sowie der zukünftigen Patin. Kurz darauf dann das erste Treffen zwischen Patin und Kind allein. Cox entschied sich für einen Zoobesuch mit dem Fünfjährigen. „Am Anfang war er natürlich sehr schüchtern. Aber ich war auch nervös.“ Der Ausflug half, das Eis zu brechen. Seit diesem Nachmittag ist die Beziehung der beiden kontinuierlich gewachsen. Die Studentin trifft ihr Patenkind jeden Sonntag für vier Stunden. Sie gehen gemeinsam auf den Spielplatz, basteln oder kochen bei ihr zuhause. „Ich glaube es ist wichtig, dass man das Kind dort abholt, wo es steht. Und im Tempo des Kindes mit ihm arbeitet. Wenn Elias und ich das Gefühl haben, wir müssen jetzt auf dem Spielplatz hundertmal rutschen – dann gehen wir hundertmal rutschen. Fertig.“
Bereicherung und Freude
Dieser Sonntagnachmittag bedeutet zugleich eine Entlastung für Elias’ Mutter. „Bei Familien mit psychischen Erkrankungen sind oft Schuldgefühle da“, sagt Jenny Cox. „Weil der Elternteil merkt, dass man dem Kind nicht alles geben kann.“ Deshalb ist sich die Studentin sicher, die Mutter gebe ihr Elias immer gern mit – im Wissen, er habe in diesen Stunden eine gute Zeit. „Für mich sind diese Treffen genauso eine Bereicherung und Freude“, so die 25-Jährige.
Und wenn sich herausstellt, dass die Beziehung zwischen Kind und Pate doch nicht langfristig klappt? Kommunikation ist das Um und Auf: Alle sechs Wochen treffen sich alle Paten und tauschen sich aus. Für jedes Paten-Kind-Tandem ist zudem eine eigene Ansprechperson da. Auch Supervisionsgespräche mit den Psychologen werden bei Bedarf angeboten. Und zur Not wird die Patenschaft beendet – was ebenfalls schon vorgekommen ist, wie Heidemarie Eher sagt. Ein loser Kontakt zwischen ehemaliger Patin und Familie sei aber noch immer da, wie sie erzählt – zum Wohle des Kindes.
Fragt man Heidemarie Eher nach dem bewegendsten Moment ihrer Tätigkeit bei JoJo, werden ihre Augen feucht. Der ist gerade einmal ein paar Tage her. Sie sagt: „Ich habe gespürt, dass Jenny und Elias jetzt so richtig in Beziehung sind. Wenn das Kind so profitiert und auch die Patin eine solche Freude hat – das ist total schön.“

Heidemarie Eher leitet den Verein JoJo. (Foto: Michael Bartholomäus Egger, Startseite: Verein JoJo/iStockphoto)


 Autor:
Autor: Video:
Video:

 Autorin:
Autorin:

 Autorin:
Autorin:

 Autorin:
Autorin:
 Autorin:
Autorin:
 Autorin:
Autorin:



 Autorin:
Autorin: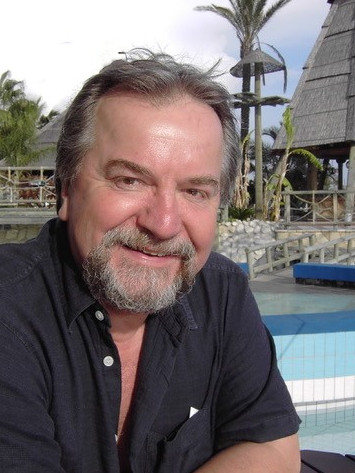






 Autor:
Autor: